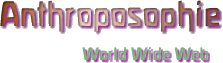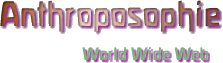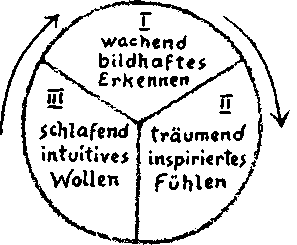Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik
Rudolf
Steiner
SECHSTER VORTRAG
Stuttgart, 27. August 1919
Wir haben bisher versucht, den Menschen zu begreifen, insofern uns
dieses Begreifen für die Erziehung des Kindes notwendig ist, vom
seelischen Standpunkte aus. Wir werden ja die drei Standpunkte
auseinanderhalten müssen - den geistigen, den seelischen und den
physischen Standpunkt - und werden, um eine vollständige
Anthropologie zu bekommen, von jedem dieser Standpunkte aus den
Menschen betrachten. Es liegt am nächsten, die seelische Betrachtung
zu vollziehen, weil dem Menschen im gewöhnlichen Leben eben das
Seelische am nächsten liegt. Und Sie werden auch empfunden haben,
daß wir, indem wir zu diesem Begreifen des Menschen als Hauptbegriffe
verwendet haben Antipathie und Sympathie, damit auf das Seelische
hingezielt haben. Es wird sich für uns nicht entsprechend erweisen,
wenn wir vom Seelischen gleich auf das Leibliche übergehen, denn wir
wissen aus unseren geisteswissenschaftlichen Betrachtungen heraus,
daß das Leibliche nur gefaßt werden kann, wenn es als eine
Offenbarung des Geistigen und auch des Seelischen aufgefaßt wird.
Daher werden wir zu der seelischen Betrachtung, die wir in allgemeinen
Linien skizziert haben, jetzt hinzufügen eine Betrachtung des
Menschen vom geistigen Gesichtspunkte aus, und wir werden dann erst
auf die eigentliche, jetzt so genannte Anthropologie, auf die
Betrachtung des Menschenwesens, wie es sich in der äußeren
physischen Welt zeigt, näher eingehen.
Wenn Sie von irgendeinem Gesichtspunkt aus den Menschen
zweckmäßig betrachten wollen, so müssen Sie immer wieder und wieder
zurückgehen auf die Gliederung der menschlichen Seelentätigkeiten in
Erkennen, das im Denken verläuft, in Fühlen und in Wollen. Wir haben
bis jetzt Denken oder Erkennen, Fühlen und Wollen in die Atmosphäre
von Antipathie und Sympathie gerückt. Wir wollen jetzt einmal eben
vom geistigen Gesichtspunkte aus Wollen, Fühlen und Erkennen ins Auge
fassen.
Sie werden auch vom geistigen Gesichtspunkte aus einen Unterschied
finden zwischen Wollen, Fühlen und denkendem Erkennen. Betrachten Sie
nur das Folgende. Indem Sie denkend erkennen, müssen Sie empfinden -
wenn ich mich zunächst bildlich ausdrücken darf, aber das Bildliche
wird uns zu Begriffen verhelfen -, daß Sie gewissermaßen im Lichte
leben. Sie erkennen und fühlen sich ganz drinnen mit Ihrem Ich in
dieser Tätigkeit des Erkennens. Gewissermaßen jeder Teil, jedes
Glied derjenigen Tätigkeit, die Sie Erkennen nennen, ist drinnen in
alledem, was Ihr Ich tut; und wieder: was Ihr Ich tut, ist drinnen in
der Tätigkeit des Erkennens. Sie sind ganz im Hellen, Sie leben in
einer vollbewußten Tätigkeit, wenn ich mich begrifflich ausdrücken
darf. Es wäre auch schlimm, wenn Sie beim Erkennen nicht in einer
vollbewußten Tätigkeit wären. Denken Sie einmal, wenn Sie das
Gefühl haben müßten: während Sie ein Urteil fällen, geht mit
Ihrem Ich irgendwo im Unterbewußten etwas vor, und das Ergebnis
dieses Vorganges sei das Urteil! Nehmen Sie an, Sie sagen: Dieser
Mensch ist ein guter Mensch -, fällen also ein Urteil. Sie müssen
sich bewußt sein, daß das, was Sie brauchen, um dieses Urteil zu
fällen - das Subjekt «der Mensch», das Prädikat «er ist ein
guter» -, Glieder sind eines Vorganges, der Ihnen ganz gegenwärtig
ist, der für Sie ganz vom Lichte des Bewußtseins durchzogen ist.
Müßten Sie annehmen, irgendein Dämon oder ein Mechanismus der Natur
knäuele zusammen den «Menschen» mit dem «Gutsein», während Sie
das Urteil fällen, dann wären Sie nicht vollbewußt in diesem
erkennenden Denkakt drinnen, und Sie wären immer mit etwas vom Urteil
im Unbewußten. Das ist das Wesentliche beim denkenden Erkennen, daß
Sie in dem ganzen Weben der Tätigkeit beim denkenden Erkennen mit
Ihrem vollen Bewußtsein drinnenstecken.
Nicht so ist es beim Wollen. Sie wissen ganz gut, wenn Sie das
einfachste Wollen, das Gehen, entwickeln, so leben Sie eigentlich
vollbewußt nur in der Vorstellung von diesem Gehen. Was innerhalb
Ihrer Muskeln sich vollzieht, während Sie ein Bein nach dem anderen
vorwärts bewegen, was da im Mechanismus und Organismus Ihres Leibes
vorgeht, von dem wissen Sie nichts. Denken Sie nur, was Sie alles zu
lernen haben würden von der Welt, wenn Sie alle die Vorrichtungen
bewußt vollziehen müßten, welche beim Wollen des Gehens notwendig
sind! Sie müßten dann genau wissen, wieviel von den Tätigkeiten,
welche die Nahrungsstoffe in den Muskeln Ihrer Beine und in den
anderen Körpermuskeln hervorrufen, verbraucht wird, während Sie sich
anstrengen, zu gehen. Sie haben das nie ausgerechnet, wieviel Sie von
dem verbrauchen, was Ihnen die Nahrung zuführt. Sie wissen ganz gut:
Das alles geschieht in Ihrer Körperlichkeit sehr, sehr unbewußt.
Indem wir wollen, mischt sich fortwährend in unsere Tätigkeit ein
tiefes Unbewußtes hinein. Das ist nicht etwa bloß so, wenn wir das
Wesen des Wollens an unserem eigenen Organismus betrachten. Auch was
wir vollbringen, wenn wir unser Wollen auf die äußere Welt
erstrecken, auch das umfassen wir keineswegs vollständig mit dem
Lichte des Bewußtseins.
Nehmen Sie an, Sie haben zwei säulenartige Pflöcke. Sie nehmen
sich vor, Sie legen einen dritten Pflock quer darüber. Unterscheiden
Sie jetzt genau, was in alledem, was Sie da getan haben, als
vollbewußte erkennende Tätigkeit lebt, von dem, was
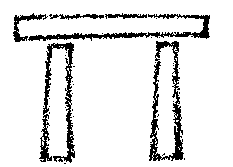
in Ihrer vollbewußten Tätigkeit lebt, wenn Sie das Urteil
fällen: Ein Mensch ist gut -, wo Sie mit Ihrem Erkennen ganz
drinnenstecken. Unterscheiden Sie bitte, was darin als erkennende
Tätigkeit lebt, von dem, wovon Sie nichts wissen, trotzdem Sie es mit
Ihrem vollen Willen zu tun hatten: Warum stützen diese zwei Säulen
durch gewisse Kräfte diesen darüberliegenden Balken? Dafür hat ja
die Physik bis heute nur Hypothesen. Und wenn die Menschen glauben,
daß sie wissen, warum die beiden Pflöcke den Balken tragen, so
bilden sie es sich nur ein. Alles, was man hat als Begriffe der
Kohäsion, der Adhäsion, der Anziehungs- und Abstoßungskraft,
sind im Grunde genommen für das äußere Wissen nur Hypothesen. Wir
rechnen mit diesen äußeren Hypothesen, indem wir handeln; wir
rechnen damit, daß die beiden Pflöcke, die den Balken tragen sollen,
nicht zusammenknicken werden, wenn sie eine gewisse Dicke haben. Aber
durchschauen können wir den ganzen Vorgang, der damit zusammenhängt,
nicht, geradesowenig wie wir unsere Beinbewegungen durchschauen
können, wenn wir vorwärts streben. So mischt sich auch hier in unser
Wollen ein nicht in unser Bewußtsein hineinreichendes Element hinein.
Das Wollen hat im weitesten Umfange ein Unbewußtes in sich.
Und das Fühlen steht zwischen Wollen und denkendem Erkennen mitten
drinnen. Beim Fühlen ist es auch so, daß es zum Teil von Bewußtsein
durchzogen wird, zum Teil von einem Unbewußten. Das Fühlen nimmt
auch in dieser Weise teil an der Eigenschaft eines erkennenden
Denkens, auf der anderen Seite an der Eigenschaft eines fühlenden
oder gefühlten Wollens. Was liegt denn nun da eigentlich vom
geistigen Gesichtspunkte aus vor?
Sie kommen nur zurecht, wenn Sie sich vom geistigen Gesichtspunkte
aus die oben charakterisierten Tatsachen in der folgenden Art zum
Begreifen bringen. Wir reden in unserem gewöhnlichen Leben vom
Wachen, von dem wachen Bewußtseinszustande. Aber wir haben diesen
wachen Bewußtseinszustand nur in der Tätigkeit des erkennenden
Denkens. Wenn Sie also ganz genau davon reden wollen, inwiefern der
Mensch wacht, so müssen Sie sagen: Wirklich wachend ist der Mensch
nur, solange und insofern er ein denkender Erkenner von irgend etwas
ist.
Wie steht es nun mit dem Wollen? Sie kennen alle den
Bewußtseinszustand - nennen Sie es meinetwillen auch
Bewußtseinslosigkeitszustand - des Schlafes. Sie wissen, während wir
schlafen, vom Einschlafen bis zum Aufwachen, ist das, was wir erleben,
nicht in unserem Bewußtsein drinnen. Geradeso ist es aber auch mit
alledem, was als Unbewußtes unser Wollen durchzieht. Insofern wir
wollende Wesen sind als Menschen, schlafen wir, auch wenn wir wachen.
Wir tragen immer mit uns einen schlafenden Menschen, nämlich den
wollenden Menschen, und begleiten ihn mit dem wachenden, mit dem
denkend erkennenden Menschen; wir sind, insofern wir wollende Wesen
sind, auch vom Aufwachen bis zum Einschlafen schlafend. Es schläft
immer etwas in uns mit, nämlich die innere Wesenheit des Wollens. Der
sind wir uns nicht stärker bewußt, als wir uns derjenigen Vorgänge
bewußt sind, die sich mit uns abspielen während des Schlafes. Man
erkennt den Menschen nicht vollständig, wenn man nicht weiß, daß
das Schlafen in sein Wachen hereinspielt, indem der Mensch ein
Wollender ist.
Das Fühlen steht in der Mitte, und wir dürfen uns jetzt fragen:
Wie ist das Bewußtsein im Fühlen? - Das steht nun auch in der Mitte
zwischen Wachen und Schlafen. Gefühle, die in Ihrer Seele leben,
kennen Sie gerade so, wie Sie Träume kennen, nur daß Sie die Träume
erinnern und die Gefühle unmittelbar erleben. Aber die innere
Seelenverfassung und Seelenstimmung die Sie haben, indem Sie von Ihren
Gefühlen wissen, ist keine andere als die, welche Sie gegenüber
Ihren Träumen haben. Sie sind im Wachen nicht nur ein wachender
Mensch, indem Sie denkend erkennen, und ein schlafender, insofern Sie
wollen, Sie sind auch ein träumender, insofern Sie fühlen. So sind
also tatsächlich drei Bewußtseinszustände während unseres Wachens
über uns ergossen: das Wachen im eigentlichen Sinne im denkenden
Erkennen, das Träumen im Fühlen, das Schlafen im Wollen. Der
gewöhnliche traumlose Schlaf ist vom geistigen Gesichtspunkte aus
angesehen nichts anderes als die Hingabe des Menschen mit seiner
ganzen Seelenwesenheit an das, woran er hingegeben ist mit seinem
Wollen, während er seinen Tageslauf vollbringt. Es ist nur der
Unterschied, daß wir im eigentlichen Schlafen mit unserem ganzen
Seelenwesen schlafen, daß wir im Wachen nur schlafen mit unserem
Wollen. Beim Träumen, was man im gewöhnlichen Leben so nennt, ist es
so, daß wir mit unserem ganzen Menschen an den Seelenzustand
hingegeben sind, den wir Traum nennen, und daß wir im Wachen nur als
fühlender Mensch an diesen träumerischen Seelenzustand hingegeben
sind.
Pädagogisch betrachtet werden Sie sich jetzt nicht mehr
verwundern, wenn Sie die Sache so ansehen, daß die Kinder verschieden
sind mit Bezug auf die Wachheit ihres Bewußtseins. Denn Sie werden
finden, daß Kinder, bei denen das Gefühlsleben der Anlage gemäß
überwiegt, träumerische Kinder sind, so daß solche Kinder, bei
denen in der Kindheit eben das volle Denken noch nicht aufgewacht ist,
leicht hingegeben sein werden an ein träumerisches Wesen. Das werden
Sie dann zum Anlaß nehmen, um durch starke Gefühle auf ein solches
Kind zu wirken. Und Sie werden dann die Hoffnung haben können, daß
diese starken Gefühle bei ihm auch das helle Erkennen erwecken
werden, denn alles Schlafen hat dem Lebensrhythmus gemäß die
Tendenz, nach einiger Zeit aufzuwachen. Wenn wir nun ein solches Kind,
das träumerisch im Gefühlsleben dahinbrütet, mit starken Gefühlen
angehen, dann werden diese in das Kind versetzten starken Gefühle
nach einiger Zeit von selbst als Gedanken aufwachen.
Kinder, die noch mehr brüten, die sogar stumpf sind gegenüber dem
Gefühlsleben, die werden Ihnen offenbaren, daß sie besonders im
Willen stark veranlagt sind. Sie sehen da: wenn Sie dies bedenken,
können Sie erkennend vor manchem Rätsel im kindlichen Leben stehen.
Sie können ein Kind in die Schule hereinbekommen, das sich ausnimmt
wie ein echter Stumpfling. Wenn Sie da gleich das Urteil fällen: Das
ist ein schwachsinniges, ein stumpfsinniges Kind -, wenn Sie es mit
experimenteller Psychologie untersuchen würden, schöne
Gedächtnisprüfungen vornähmen und allerlei, was ja jetzt auch schon
in psychologisch-pädagogischen Laboratorien gemacht wird und dann
sagen würden: Stumpfes Kind seiner ganzen Anlage nach, gehört in die
Schwachsinnigen-Schule oder auch in die jetzt beliebte
Wenigerbefähigten-Schule, so würden Sie mit solchem Urteil nicht dem
Wesen des Kindes nahekommen. Vielleicht aber ist dieses Kind besonders
stark im Willen veranlagt, vielleicht ist es eines jener Kinder, die
im späteren Leben aus ihrer Cholerik zu tatkräftigem Handeln
übergehen. Aber der Wille schläft zunächst. Und wenn das denkende
Erkennen bei diesem Kinde verurteilt ist, später erst hervorzutreten,
dann muß es auch in der entsprechenden Weise behandelt werden, damit
es dann später berufen sein kann, etwas Tatkräftiges zu vollbringen.
Vorerst erscheint es als ein rechter Stumpfling, der ist es aber
vielleicht gar nicht. Und man muß dann den Blick dafür haben, bei
einem solchen Kinde den Willen zu erwek-ken; das heißt, man muß so
in seinen wachen Schlafzustand hineinwirken, daß es nach und nach
dahinkommt - weil ja jeder Schlaf die Tendenz hat, zum Erwachen zu
kommen -, seinen Schlaf als Willen, der vielleicht sehr stark ist, der
aber nur jetzt schläft, vom schlafenden Wesen übertönt wird, im
späteren Lebensalter aufzuwecken. Ein solches Kind muß so behandelt
werden, daß Sie möglichst wenig auf sein Erkenntnisvermögen, auf
sein Begreifen bauen, sondern ihm gewissermaßen einhämmern einige
recht stark auf den Willen wirkende Sachen, daß Sie es, indem es
spricht, zu gleicher Zeit gehen lassen. Sie nehmen ein solches Kind,
Sie werden ja nicht sehr viele davon haben, aus der Klasse heraus und
- für die anderen Kinder wird es anregend sein, für dieses Kind ist
es bildend - lassen es, indem es Sätze spricht, die Worte mit
Bewegungen begleiten. Also: Der (Schritt) - Mensch (Schritt) -ist
(Schritt) - gut! - Auf diese Weise verbinden Sie den ganzen Menschen
im Willenselement mit dem bloß Intellektuellen im Erkennen, und Sie
können es nach und nach dahin bringen, daß bei einem solchen Kinde
der Wille zum Gedanken erwacht. Erst die Einsicht, daß man es im
wachenden Menschen schon zu tun hat mit verschiedenen
Bewußtseinszuständen - mit Wachen, Träumen und Schlafen -, erst
diese Einsicht bringt uns zu einer wirklichen Erkenntnis unserer
Aufgaben gegenüber dem werdenden Menschen.
Wir können aber jetzt etwas fragen. Wir können fragen: Wie
verhält sich das eigentliche Zentrum des Menschen, das Ich, zu diesen
verschiedenen Zuständen? Sie kommen am leichtesten dabei zurecht,
wenn Sie zunächst, was ja unleugbar ist, voraussetzen: Was wir Welt,
was wir Kosmos nennen, das ist eine Summe von Tätigkeiten. Für uns
drücken sich diese Tätigkeiten aus auf den verschiedenen Gebieten
des elementaren Lebens. Wir wissen, daß in diesem elementaren Leben
Kräfte walten. Die Lebenskraft waltet zum Beispiel um uns herum. Und
zwischen den elementaren Kräften und der Lebenskraft eingesponnen ist
alles, was zum Beispiel die Wärme und das Feuer bewirkt. Denken Sie
nur, wie sehr wir in einer Umgebung stehen, in der durch das Feuer
sehr vieles bewirkt wird.
In gewissen Gegenden der Erde, zum Beispiel in Süditalien,
brauchen Sie nur eine Papierkugel anzuzünden, und in demselben
Augenblick fängt es an, aus der Erde heraus mächtig zu rauchen.
Warum geschieht das? Es geschieht, weil Sie durch das Anzünden der
Papierkugel und die sich dadurch entwickelnde Wärme die Luft an
dieser Stelle verdünnen, und das, was sonst unter der Erdoberfläche
an Kräften waltet, wird durch den nach aufwärts gerichteten Rauch
nach oben gezogen, und in dem Augenblick, wo Sie die Papierkugel
anzünden und auf die Erde werfen, stehen Sie in einer Rauchwolke. Das
ist ein Experiment, das jeder Reisende machen kann, der in die Gegend
von Neapel kommt. Das habe ich als ein Beispiel dafür angeführt,
daß wir, wenn wir die Welt nicht oberflächlich betrachten, uns sagen
müssen: Wir leben in einer Umgebung, die überall von Kräften
durchzogen ist.
Nun gibt es auch höhere Kräfte als die Wärme. Die sind auch in
unserer Umgebung. Durch sie gehen wir immer durch, indem wir als
physische Menschen durch die Welt gehen. Ja, unser physischer Körper,
ohne daß wir es im gewöhnlichen Erkennen wissen, ist so geartet,
daß wir das vertragen. Mit unserem physischen Körper können wir so
durch die Welt schreiten.
Mit unserem Ich, das die jüngste Bildung unserer Evolution ist,
könnten wir nicht durch diese Weltenkräfte schreiten, wenn dieses
Ich sich unmittelbar an diese Kräfte hingeben sollte. Dieses Ich
könnte nicht an alles sich hingeben, was in seiner Umgebung ist und
worin es selbst drinnen ist. Dieses Ich muß jetzt noch davor bewahrt
werden, sich ergießen zu müssen in die Weltenkräfte. Es wird sich
einmal dazu entwickeln, in die Weltenkräfte hinein aufgehen zu
können. Jetzt kann es das noch nicht. Deshalb ist es notwendig, daß
wir für das völlig wache Ich nicht versetzt werden in die wirkliche
Welt, die in unserer Umgebung ist, sondern nur in das Bild der Welt.
Daher haben wir in unserem denkenden Erkennen eben nur die Bilder der
Welt, was wir vom seelischen Gesichtspunkte aus schon angeführt
haben.
Jetzt betrachten wir es auch vom geistigen Gesichtspunkte aus. Im
denkenden Erkennen leben wir in Bildern; und wir Menschen auf der
gegenwärtigen Entwickelungsstufe innerhalb von Geburt und Tod können
mit unserem vollwachenden Ich nur in Bildern von dem Kosmos leben,
noch nicht in dem wirklichen Kosmos. Daher muß, wenn wir wachen,
unser Leib uns zuerst die Bilder des Kosmos hervorbringen. Dann lebt
unser Ich in den Bildern von diesem Kosmos.
Die Psychologen geben sich furchtbar viel Mühe, die Beziehungen
zwischen Leib und Seele zu konstatieren. Sie reden von Wechselwirkung
zwischen Leib und Seele, reden vom psycho-physischen Parallelismus und
auch von anderen Dingen noch. Alle diese Dinge sind im Grunde genommen
kindliche Begriffe. Denn der wirkliche Vorgang dabei ist der: Wenn das
Ich des Morgens in den Wachzustand übergeht, so dringt es in den Leib
ein, aber nicht in die physischen Vorgänge des Leibes, sondern in die
Bilderwelt, die bis in sein tiefstes Inneres der Leib von den
äußeren Vorgängen erzeugt. Dadurch wird dem Ich das denkende
Erkennen übermittelt.
Beim Fühlen ist es anders. Da dringt schon das Ich in den
wirklichen Leib ein, nicht bloß in die Bilder. Wenn es aber bei
diesem Eindringen voll bewußt wäre, dann würde es - nehmen Sie das
jetzt seelisch - buchstäblich seelisch verbrennen. Wenn Ihnen
dasselbe passierte beim Fühlen, was Ihnen passiert beim Denken, indem
Sie in die Bilder, die Ihnen Ihr Leib erzeugt, mit Ihrem Ich
eindringen, dann würden Sie seelisch verbrennen. Sie würden es nicht
aushallen. Sie können dieses Eindringen, welches das Fühlen
bedeutet, nur träumend, im herabgedämpften Bewußtseinszustande
erleben. Nur im Traume halten Sie das aus, was beim Fühlen in Ihrem
Leib eigentlich vor sich geht.
Und was beim Wollen sich abspielt, das können Sie überhaupt nur
erleben, indem Sie schlafen. Das wäre etwas ganz Schreckliches, was
Sie erleben würden, wenn Sie im gewöhnlichen Leben alles miterleben
müßten, was mit Ihrem Wollen vor sich geht. Der entsetzlichste
Schmerz ergriffe Sie zum Beispiel, wenn Sie, was ich schon andeutete,
wirklich erleben müßten, wie sich die durch die Nahrungsmittel dem
Organismus zugeführten Kräfte beim Gehen verbrauchen in Ihren
Beinen. Es ist schon Ihr Glück, daß Sie das nicht erleben
beziehungsweise nur schlafend erleben. Denn wachend dies erleben,
würde den denkbar größten Schmerz bedeuten, einen furchtbaren
Schmerz. Man könnte sogar sagen: das Erwachen ins Wollen besteht
darin, daß für den Menschen, insofern er ein wollender ist, der
Schmerz, der nur latent bleibt, betäubt wird durch den Schlafzustand
im Wollen.
Daher werden Sie verstehen, wenn ich Ihnen jetzt das Leben des Ich
charakterisiere während dessen, was man im gewöhnlichen Leben
Wachzustand nennt - was also umfaßt: voll Wachen, träumend Wachen,
schlafend Wachen -, wenn ich charakterisiere, was das Ich, indem es im
gewöhnlichen Wachzustande im Leibe lebt, eigentlich in Wirklichkeit
durchlebt. Dieses Ich lebt im denkenden Erkennen, indem es aufwacht in
den Leib; da ist es voll wach. Es lebt darin aber nur in Bildern, so
daß der Mensch in seinem Leben zwischen Geburt und Tod, wenn er nicht
solche Übungen macht, wie sie in meinen! Buche «Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten?» angedeutet sind, fortwährend nur
in Bildern durch sein denkendes Erkennen lebt.
Dann senkt sich erwachend das Ich auch ein in die Vorgänge, die
das Fühlen bedingen. Fühlend leben: da sind wir nicht voll wach,
sondern da sind wir träumend wach. Wie erleben wir denn eigentlich
das, was wir da im träumenden Wachzustande fühlend durchmachen? Das
erleben wir tatsächlich in dem, was man immer genannt hat
Inspirationen, inspirierte Vorstellungen, unbewußt inspirierte
Vorstellungen. Da ist der Herd von alledem, was aus den Gefühlen beim
Künstler hinaufsteigt in das wache Bewußtsein. Dort wird es zuerst
durchgemacht. Dort wird auch alles das durchgemacht, was beim wachen
Menschen oftmals als Einfalle hinaufsteigt ins Wachbewußtsein und
dann zu Bildern wird.
Was in meinem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten?» Inspirationen genannt wird, das ist nur das zur Helligkeit,
zum Vollbewußtsein heraufgehobene Erleben desjenigen, was bei jedem
Menschen unten im Gefühlsleben unbe-
fühlend Leben
träumend wach in unbewußten
inspirierten Vorstellungen |
|
denkend Erkennen
voll wach in Bildern |
|
Ich
|
|
|
wollend Tun
schlafend unbewußt in Intuitionen |
wußt an Inspirationen vorhanden ist. Und wenn besonders veranlagte
Leute von ihren Inspirationen sprechen, so sprechen sie eigentlich von
dem, was die Welt in ihr Gefühlsleben hineingelegt hat und durch ihre
Anlagen heraufkommen läßt in ihr volles Wachbewußtsein. Es ist das
ebenso Weltinhalt, wie der Gedankeninhalt Weltinhalt ist. Aber in dem
Leben zwischen Geburt und Tod spiegeln diese unbewußten Inspirationen
solche Weltenvorgänge, die wir nur träumend erleben können; sonst
würde unser Ich in diesen Vorgängen sich verbrennen, oder es würde
ersticken, namentlich ersticken. Dieses Ersticken beginnt auch
manchmal beim Menschen in abnormen Zuständen. Denken Sie nur einmal,
Sie haben Alpdruck. Dann will ein Zustand, der sich abspielt zwischen
Ihnen und der äußeren Luft, wenn bei einem Menschen in diesem
Wechselverhältnis nicht alles in Ordnung ist, in abnormer Weise
übergehen in etwas anderes. Indem das übergehen will in Ihr
Ich-Bewußtsein, wird es Ihnen nicht als eine normale Vorstellung
bewußt, sondern als eine Sie quälende Vorstellung: als der Alpdruck.
Und so qualvoll wie das abnorme Atmen im Alpdruck, so qualvoll wäre
das gesamte Atmen, wäre jeder Atemzug, wenn der Mensch das Atmen
vollbewußt erleben würde. Er würde es fühlend erleben, aber
qualvoll wäre es für ihn. Es wird daher abgestumpft, und so wird es
nicht als physischer Vorgang, sondern nur in dem träumerischen
Gefühl erlebt.
Und gar die Vorgänge, die sich beim Wollen abspielen, ich habe es
Ihnen schon angedeutet: furchtbarer Schmerz wäre das! Daher können
wir weiter sagen als drittes: Das Ich im wollenden Tun ist schlafend.
Da wird das erlebt, was erlebt wird mit stark herabgedämpftem
Bewußtsein - eben im schlafenden Bewußtsein - in unbewußten
Intuitionen. Unbewußte Intuitionen hat der Mensch fortwährend; aber
sie leben in seinem Wollen. Er schläft in seinem Wollen. Daher kann
er sie auch nicht im gewöhnlichen Leben heraufholen. Sie kommen nur
in Glückszuständen des Lebens herauf; dann erlebt der Mensch ganz
dumpf die geistige Welt mit.
Nun ist etwas Eigentümliches beim gewöhnlichen Leben des Menschen
vorhanden. Das Vollbewußtsein im vollen Wachen beim denkenden
Erkennen, das kennen wir ja alle. Da sind wir sozusagen in der
Helligkeit des Bewußtseins, darüber wissen wir Bescheid. Manchmal
fangen dann die Menschen an, wenn sie über die Welt etwas nachdenken,
zu sagen: Wir haben Intuitionen. Unbestimmt Gefühltes bringen die
Menschen dann aus diesen Intuitionen heraus vor. Was sie da sagen,
kann manchmal etwas sehr Verworrenes sein, aber es kann auch unbewußt
geregelt sein. Und schließlich, wenn der Dichter von seinen
Intuitionen spricht, so ist das durchaus richtig, daß er sie
zunächst nicht herausholt aus dem Herd, wo sie ihm am nächsten
liegen, aus den inspirierten Vorstellungen des Gefühlslebens, sondern
er holt hervor seine ganz unbewußten Intuitionen aus der Region des
schlafenden Wollens.
Wer in diese Dinge hineinsieht, der sieht selbst in scheinbaren
Zufälligkeiten des Lebens tiefe Gesetzmäßigkeiten. Man liest zum
Beispiel den zweiten Teil von Goethes «Faust», und man möchte sich
ganz gründlich davon unterrichten, wie gerade diese merkwürdigen
Verse in ihrem Bau hervorgebracht werden konnten. Goethe war
schon alt, als er den zweiten Teil seines «Faust» schrieb,
wenigstens den größten Teil davon. Er schrieb ihn so, daß John,
sein Sekretär, am Schreibtische saß und das schrieb, was Goethe
diktierte. Hätte Goethe selber schreiben müssen, so hätte er
wahrscheinlich nicht so merkwürdig ziselierte Verse für den zweiten
Teil seines «Faust» hervorgebracht. Goethe ging, während er
diktierte, in seiner kleinen Weimarer Stube fortwährend auf und ab,
und dieses Auf- und Abgehen gehört mit zur Konzeption des zweiten
Teiles des «Faust». Indem Goethe dieses unbewußte wollende Tun im
Gehen entwickelte, drängte aus seinen Intuitionen etwas herauf, und
in seiner äußeren Tätigkeit offenbarte sich dann dasjenige, was er
durch einen anderen auf das Papier schreiben ließ.
Wenn Sie sich ein Schema machen wollen von dem Leben des Ich im
Leibe, und Sie machen es sich in der folgenden Weise:
I. wachend - bildhaftes Erkennen
II. träumend - inspiriertes Fühlen
III. schlafend - intuitierendes oder intuitiertes Wollen |
dann werden Sie sich nicht recht begreiflich machen können, warum
das Intuitive, von dem die Menschen instinktiv sprechen, leichter
heraufkomme ins bildhafte Erkennen des Alltags als das näherliegende
inspirierte Fühlen. Wenn Sie sich nun das Schema jetzt richtig
zeichnen - denn hier oben ist es falsch gezeichnet -, wenn Sie es in
der Weise machen, wie in der Zeichnung, dann werden Sie die Sache
leichter begreifen. Denn dann werden Sie sich sagen: In der Richtung
des Pfeils (1) steigt das bildhafte Erkennen hinunter in die
Inspirationen, und es kommt wieder herauf aus den Intuitionen (Pfeil
2). Aber dieses Erkennen, das mit dem Pfeil l angedeutet ist, ist das
Hinuntersteigen in den Leib. Und jetzt betrachten Sie sich; Sie sind
zunächst ganz ruhig, sitzend oder stehend, geben sich nur dem
denkenden Erkennen hin, der Betrachtung der Außenwelt. Da leben Sie
im Bilde. Was sonst das Ich erlebt an den Vorgängen, steigt hinunter
in den Leib, erst ins Fühlen, dann ins
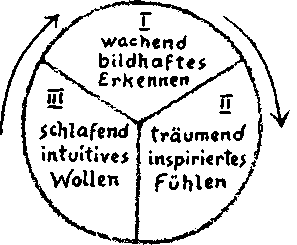
Wollen. Was im Fühlen ist, beachten Sie nicht,
was im Wollen ist, beachten Sie zunächst auch nicht. Nur wenn Sie
anfangen zu gehen, wenn Sie anfangen zu handeln, dann betrachten Sie
äußerlich-nicht zuerst das Fühlen, sondern das Wollen. Und da, beim
Hinuntersteigen in den Leib und beim Wiederheraufsteigen, was in der
Richtung des Pfeiles 2 vor sich geht, da hat das intuitive Wollen es
näher, zum bildhaften Bewußtsein zu kommen als das träumende
inspirierte Fühlen. Daher werden Sie finden, daß die Menschen so oft
sagen: Ich habe eine unbestimmte Intuition. - Da wird dann das, was in
meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?»
Intuitionen genannt wird, mit der oberflächlichen Intuition des
gewöhnlichen Bewußtsein verwechselt.
Jetzt werden Sie etwas begreifen von der Gestalt des menschlichen
Leibes. Denken Sie sich jetzt einmal einen Augenblick gehend, aber die
Welt betrachtend. Denken Sie sich: Nicht Ihr Unterleib müßte mit den
Beinen gehen, sondern Ihr Kopf würde direkt die Beine haben und
müßte gehen. Da würde in eins verwoben sein Ihr Weltbetrachten und
Ihr Wollen, und die Folge wäre, daß Sie nur schlafend gehen
könnten. Indem Ihr Kopf aufgesetzt ist auf die Schultern und auf den
übrigen Leib, ruht er auf dem übrigen Leibe. Er ruht, und Sie tragen
Ihren Kopf, indem Sie sich nur mit dem anderen Leib bewegen. Der Kopf
muß aber auf dem Leibe ruhen können, sonst könnte er nicht das
Organ des denkenden Erkennens sein. Er muß dem schlafenden Wollen
entzogen werden, denn in dem Augenblick, wo Sie ihn in die Bewegung
überführen, wo Sie ihn aus der relativen Ruhe in eine selbstgemachte
Bewegung überführen würden, da würde er zum Schlafen kommen. Das
eigentliche Wollen läßt er den Leib vollziehen, und er lebt in
diesem Leibe drinnen wie in einer Kutsche und läßt sich von diesem
Wagen weiterbefördern. Nur dadurch, daß sich der Kopf wie in einer
Kutsche von dem Wagen des Leibes weiterbefördern läßt und während
dieses Weiterbeförderns, während dieses Rubens handelt, ist der
Mensch wachend handelnd. Nur wenn Sie die Dinge so zusammenhalten,
kommen Sie auch zu einem wirklichen Begreifen der Gestalt des
menschlichen Leibes.
1. Auflage, Dornach 1932